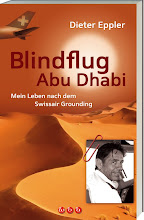Das Jahr 2007, und damit rund 800 Flugstunden und 47 Landungen im Etihad-Cockpit gehören der Vergangenheit an – vor uns liegt ein jungfräuliches 2008. Zwölf Monate, die Träume wecken und Hoffnungen schüren.
Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt, eingeweiht und möglicherweise bereits wieder umgetauscht. Angefressene Pfunde werden fleissig wegtrainiert, kleine und grosse Firmen diskutieren neue Budgets, derweil die politische Ordnung in einigen Teilen dieser Welt völlig aus den Fugen geraten ist. Die Börsen haben das Jahr auf ihre Weise begonnen und sind fürs Erste abgetaucht.
Und über all dem steht unsere ganz individuelle Frage nach den persönlichen Aussichten für das kommende Jahr.
Weihnachten in Abu Dhabi
Franziska und die Kinder reisen grosszügigerweise nicht gleich nach Ferienbeginn am 18. Dezember in die Schweiz. Nachdem wir im vergangenen Jahr Weihnachten getrennt feiern mussten, wollen wir heuer zumindest den Heiligen Abend gemeinsam verbringen. Am frühen Morgen lande ich von New York kommend in Abu Dhabi. Erleichtert über den Umstand, dass uns kein Blizzard in den USA blockiert hat.
Viel Schlaf gibt es nach dem Flug allerdings nicht, wie immer habe ich Geschenke in letzter Minute einzupacken, wobei mir Nina grosszügigerweise hilft. Zum Glück, denn ein guter „Handwerker“ war ich noch nie, und meine „Geschenkpäckli“-Kreationen lösen in der Regel mehr Belustigung als erwartungsvolle Vorfreude aus. Am Nachmittag reicht es gar noch für eine Tennispartie, bei der sich am Schluss die ganze Familie auf dem Court tummelt. Das ist definitiv ein Novum: das Racket haben wir am 24. Dezember noch nie geschwungen, schon gar nicht im Freien.
Am Abend liegen unter unserem künstlichen Weihnachtsbaum mehr Geschenke als erwartet. Ein stimmungsvoller Anblick, der an ganz „normale“ Weihnachten früherer Jahre erinnert. Und wie wir dies in Stadel immer taten, begeben wir uns auch hier vor der Feier auf einen Spaziergang. Das Umfeld ist nicht identisch: Compound statt Zürcher Unterländer Dorf, mediterran wirkende Wohneinheiten statt Riegelhäuser, 20 Grad Celsius statt Frost und Kälte. Doch wie in der Schweiz bestaunen wir auch im Al Qurm Compound die vielen Lichter, mit denen zahlreiche Familien ihre Häuser geschmückt haben. Hie und da erlauben vorhanglose Fenster einen Blick ins Stubeninnere, wo nicht selten Christbäume ihren Glanz verbreiten. Erstaunlich, wie schnell irgendwo in der Welt – wohl dank intensiver Kindheitserinnerungen – weihnachtliche Gefühle aufkommen.
 Stilleben mit Tannenbaum...
Stilleben mit Tannenbaum... ...und mit Filet
...und mit Filet Abendstimmung im Al Qurm CompoundAbreise in die Schweiz
Abendstimmung im Al Qurm CompoundAbreise in die Schweiz
Den 25. Dezember geniessen wir ebenfalls gemeinsam und fahren zum Abendessen in ein japanisches Lokal im Zentrum der Stadt: Teppanyaki ist angesagt. Ein Wunsch der Kinder, auch in der Schweiz gehörte dies in der Altjahreswoche zum Pflichtprogramm. Der vor unseren Augen wild mit Messern hantierende exotische Koch – hier selten ein Japaner sondern viel eher ein Thailänder – bietet eindrückliche Künste und fasziniert stets aufs Neue.
Kurz nach Mitternacht bringe ich die Familie zum Airport. Der Flug nach Frankfurt startet um 0230 Uhr. Für die Familie habe ich unsere „Annual Leave“ Tickets geordert. Diese berechtigen Etihad-Angestellte und deren Anhang einmal jährlich gratis und fest gebucht in die Heimat zu reisen. Klingt grosszügiger als es tatsächlich ist, weil es in der Praxis oft nicht wie gewünscht klappt. Doch dieses Mal funktioniert alles (beinahe) perfekt. Ich brauche „nur“ einmal dezent zu intervenieren, bis Franziska und die Kinder – ihrem Anspruch entsprechend – in die First Class eingecheckt werden. Zumindest bis Frankfurt. Für den Anschlussflug mit der Lufthansa nach Zürich gilt dieses Privileg nicht mehr.
In der Schweiz, im Diemtigtal, warten Sonne und Schnee. Die Wohnung ist eingeheizt und die fünf Gäste, Linda’s Freund Nathan ist auch dabei, sind voller Tatendrang. Mir wird nach den ersten SMS weh ums Herz. Wie gern würde ich wieder einmal meine Bretter aus dem Keller holen! Letztes Jahr reichte es nicht für eine einzige Fahrt und auch diese Saison werde ich es wohl kaum schaffen. Glücklicherweise wurden bereits meine Weihnachtsferien 2008 bestätigt, so dass ich berechtigte Hoffnung hege, meine Skier im kommenden Winter aus der Untätigkeit erlösen zu können. Vorläufig tröste ich mich mit der „Ski Challenge 08“ am Laptop. Das „Kratzen“ der Kanten beim schnellen Kurvenfahren klingt unheimlich echt, abgesehen davon, dass Stürze überhaupt nicht weh tun...
Simulator, Toronto und Planungsprobleme
Während Frau und Kinder tief verschneite Hänge runterschwingen, steht für mich mein halbjährlicher „OPC“ (Operator Proficiency Check) im Simulator an. Die Ruhe im Haus lässt mir Zeit, im Vorfeld versäumte Vorbereitungsarbeiten zu erledigen. Allerdings bin ich wenig motiviert, denn aus Kapazitätsgründen gibt’s nicht wie üblich am Vortag eine „Recurrent“-Übung mit zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten. Und der Check alleine verlangt nicht ein derart riesiges Mass an Vorbereitung. Ich liege nicht schlecht mit meiner Einschätzung und bringe diese Pflicht ziemlich flüssig hinter mich. Mit italienischem Instruktor und einem Copi aus Trinidad. Letzteren treffe ich am späten Abend des 31. Dezember am Flughafen im Planungsraum wieder. Es ist kurz vor Mitternacht, unsere Check In Zeit beträgt 00.10 Uhr. Der Jahreswechsel verläuft völlig unspektakulär. Ich bin in eine intensive Diskussion mit dem Dispatcher verwickelt, da sich die Planung für unseren Flug nach Kanada kompliziert gestaltet: Toronto meldet zum Zeitpunkt unserer Ankunft dichten Schneefall, böige Winde und eine Sicht von lediglich einer Viertelmeile. Eine hohe Zuladung sowie starke Gegenwinde verlangen nach viel Sprit. Die NOTAMS, Angaben zur Route und zum aktuellen Flugplatzstatus, sind unvollständig. Der Dispatcher erklärt mir, dass wir mit dem aktuellen spezifischen Gewicht des Kerosins an der Kapazitätsgrenze der insgesamt acht Tanks anstehen. Ich stosse mehr als nur einen tiefen Seufzer aus und wünsche mir für den weiteren Verlauf des noch jungen Jahres positivere Zeichen.
Wir bringen schliesslich alles unter Dach und Fach: Eine Reduktion des „Zero Fuel Weight“ erlaubt uns, 152 Tonnen Sprit zu tanken und die Dame vom Load Control können wir überzeugen, nicht die acht „Stand bye“-Passagiere sondern etwas Fracht auszuladen. Immerhin ist Silvester...
Schliesslich rollen wir mit einem 380 Tonnen schweren Airbus A340-600 zur Piste 13. Wir sind lediglich 24 Kilo unter dem maximalen Abfluggewicht und es dauert eine Ewigkeit, bis sich der lange Rumpf samt dem Rest des Fliegers endlich vom Boden löst.
Schneetreiben und Go AroundDie Gegenwinde blasen stark, unsere Flugzeit beträgt 14 Stunden und 30 Minuten. Ich bin „Crew A“ und trage damit – zusammen mit meinem Copi – die operationelle Verantwortung für den Flug. Dazu gehören auch die Durchführung von Start und Landung, ausserdem sitzen wir während der ersten sechseinhalb Stunden im Cockpit. Bei einer Startzeit kurz nach 0200 Uhr ist dies kein Zuckerschlecken. Alsbald beginnt die Müdigkeit zu nagen. Die Augenlider legen an Gewicht zu, der Geist wird träge. Das Sitzen wird zur Qual und es folgt unweigerlich der Moment, wo sämtliche Sitzvarianten ausgeschöpft sind. Ich strecke mich, stehe auf, verschränke die Hände hinter dem Kopf, versuche mich abzulenken. Aber die Stunden ziehen schleppend dahin und es dauert eine Ewigkeit bis unsere Ablösung hinter uns steht.
Nach einer Ruhezeit von etwas mehr als sechs Stunden, von denen ich gut vier Stunden schlafen kann, geht’s wieder ins Cockpit. Ich fühle mich nicht topfit aber wesentlich besser als vor der Pause. Toronto meldet mittlerweile starke Schneefälle, der Wind hat ebenfalls aufgefrischt. Zusammen mit dem emiratischen Copi Mohammed gehe ich die verschiedenen Anflugmöglichkeiten durch. In Nordamerika und Kanada muss jeweils bis kurz vor Anflugbeginn mit neuen Pistenzuordnungen gerechnet werden, was die Sache nicht unbedingt einfacher gestaltet.
Für einmal entsprechen die tatsächlichen Wetterverhältnisse den Vorhersagen. Mit Ausnahme der Sicht, die mit drei Meilen besser als erwartet ist. Einzig die tiefe Wolkendecke ist etwas unangenehm. Die schneebedeckte Landschaft bietet wenig Kontrast zur weissen Wolkenschicht, was die Umstellung vom Instrumenenflug auf den Sichtflug unmittelbar vor der Landung erschwert. Doch vorerst kommen wir gar nicht soweit. Am Funk hören wir, wie der Controller einer Maschine auf unserer Landepiste Anweisung erteilt, endlich zu starten:
„Expedite your take off roll, traffic two miles final!“ mahnt er die Cockpitcrew. Noch befinden wir uns in den Wolken, erst bei 600 Fuss werden erste Landschaftsfetzen sichtbar. Dann hören wir die Besatzung der startenden Maschine am Funk:
„...aborting Take off, exiting the Runway as soon as possible". Was auch immer sie zu diesem Vorgang veranlasst – für uns hat dies unangenehme Folgen.
„Etihad 141 pull up immediately, make a go around!“ befiehlt uns eine Stimme, die wir eine Spur lauter als vorher im Kopfhörer wahrnehmen. Ich schiebe die vier Gashebel an den vorderen Anschlag, im selben Moment rotiert der noch immer eingeschaltete Autopilot die Nase des Airbus auf 12 Grad.
„Go around – Flaps!“
Berücksichtigt man die Tatsache, dass wir über 14 Stunden Flug sowie eine Nacht mit wenig Schlaf hinter uns haben, läuft das Manöver erstaunlich flüssig und koordiniert ab. Wie so oft in ähnlichen Fällen fliegen wir nicht das auf der Anflugkarte vorgesehene Durchstartverfahren, sondern erhalten vom Tower ein „Heading“ (Kursangabe) und eine einzuhaltende Höhe. Es folgt ein Frequenzwechsel, dann ein „Right turn“, kurze Info an die Passagiere, steigen auf 4000 Fuss, wenig später absinken auf 2000 Fuss und schliesslich eindrehen in den Endanflug, wo wir knappe 15 Minuten später wieder sauber stabilisert sind. Auf 500 Fuss, rund 150 Meter über Grund, tauchen wir aus den Wolken. Alles unter und vor uns scheint milchig weiss und verschwommen.
.jpg)
.jpg) Schneetreiben am Lake OntarioTückische Rollverhältnisse
Schneetreiben am Lake OntarioTückische RollverhältnisseEs ist nicht einfach, die schneebedeckte Piste zu erkennen. Der leichte Schneefall verwischt die Konturen. Ausserdem herrscht böiger Seitenwind mit Werten nahe der zugelassenen Limiten. Wenig später setzen unsere Räder auf kanadischem Boden auf, das „Autobrake-System“ verzögert unsere Geschwindigkeit rasch und wir verlassen die Piste früher als angenommen. Das Rollen erweist sich als äusserst anspruchsvoll. Die Rollwege sind extrem glitschig. Der 75 Meter lange Rumpf des A340-600 lässt nicht zu, dass die engen Kurven „geschnitten“ werden, ansonsten das Hauptfahrwerk auf der Kurveninnenseite neben den Rollweg gerät. Die engen „turns“ verlangen einen umsichtigen und kontrollierten Umgang mit Geschwindigkeit und Schubleistung. Wer nicht Acht gibt riskiert, mit eingeschlagenem Bugrad stehen zu bleiben – wer zu schnell rollt wird Mühe haben, ein unangenehmes „Skidden“ oder Rutschen des Bugrades zu vermeiden. Oder allgemeiner formuliert: Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Wir sind froh, nach wenigen Minuten und einigen Haken endlich am Standplatz angelangt zu sein. Müde, aber zufrieden über die geleistete Arbeit. Und in glückseliger Vorfreude auf bevorstehenden Steak- und Biergenuss!
Es lebe das Jahr 2008!
.jpg) Klirrende -18 Grad Celsius
Klirrende -18 Grad Celsius
 Der Flug nach London verläuft ereignislos. Mein „Assistent“ zur Rechten erweist sich als freundlicher und kommunikativer Kollege und wir führen abwechslungsreiche Gespräche auf höchstem intellektuellem Niveau. Die Flugzeit ist mit 7.30 Stunden eher lang, vereinzelt heftige Turbulenzen hinterlassen bei mehreren Gästen einen unangenehmen Nachgeschmack (gefüllte Papiertüten sowie leichte Gleichgewichtsstörungen).
Der Flug nach London verläuft ereignislos. Mein „Assistent“ zur Rechten erweist sich als freundlicher und kommunikativer Kollege und wir führen abwechslungsreiche Gespräche auf höchstem intellektuellem Niveau. Die Flugzeit ist mit 7.30 Stunden eher lang, vereinzelt heftige Turbulenzen hinterlassen bei mehreren Gästen einen unangenehmen Nachgeschmack (gefüllte Papiertüten sowie leichte Gleichgewichtsstörungen).





.jpg)
.jpg)
.jpg)